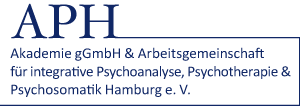Terminvergabe & Erreichbarkeit #
Erreichbarkeit
Jede/r Aus-/WeiterbildungskollegIn muss eigenverantwortlich also individuell seine/ihre telefonische und persönliche Sprechzeit regeln. Oft ist daher die Einrichtung eines eigenen Arbeits-Mobiltelefons sinnvoll und angemessen. Sie können zur Weitergabe dieser Nummer die Visitenkarten der Ambulanz verwenden und dort die Nummer handschriftlich ergänzen. Es ist geschickt diese Nummer frühzeitig zu definieren.
Telefonsprechzeiten
Wir empfehlen Ihnen, sich mit Beginn der praktischen Ausbildung Telefonsprechzeiten einzurichten, in denen Sie für Ihre PatientInnen persönlich erreichbar sind. Auf diese Sprechzeiten sollten Sie Ihre PatientInnen gleich zu Behandlungsbeginn hinweisen.
Alle AusbildungskollegInnen verpflichten sich mit Beginn der praktischen Ausbildung zu einer verlässlichen Patientinnenversorgung! Hierzu zählt auch, dass der/die AusbildungskollegIn außerhalb seiner/ihrer Sprechzeiten zeitnah auf Anrufe von PatientInnen reagiert. Dabei heißt zeitnah nicht – „immer sofort“. Sie können auch etwas variierende Vereinbarungen mit unterschiedlichen PatientInnen treffen.
Über eine klare Anrufbeantworteransage können Sie Rufnummern für eventuelle Notfälle von stationären und sozialpsychiatrischen Einrichtungen nennen.
Die direkten Erreichbarkeit zu Ihnen über eine oder mehrere Telefonnummern, SMS, Email, etc. überlegen Sie sich bitte vor dem ersten PatientInnenkontakt und rückversichern sich bei SupervisorInnen oder ggf. anderen Aus-/WeiterbildungskollegInnen. Im Erstkontakt sollten Sie mit den PatientInnen die Möglichkeiten der Erreichbarkeit außerhalb der Sprechzeiten und in Krisen, Urlaubszeiten und bei Krankheit besprechen. In einem Therapievertrag kann die Erreichbarkeit schriftlich festgelegt werden.
Es kommt häufiger vor, dass PatientInnen sich bei der Ambulanz oder Geschäftsstelle melden, um z.B. Termine abzusagen. Wenn Sie ihre Erreichbarkeiten wie oben beschrieben mit den Patienten besprechen, sollte dies vermeidbar sein.
Rechtzeitige Ankündigung der Urlaubszeiten
Bitte besprechen Sie frühzeitig mit Ihren PatientInnen Ihre Urlaubszeiten und Möglichkeiten der Krisenintervention in dieser Zeit.
Ausfall durch Krankheit des/der TherapeutIn
Bei Krankheit informieren Sie bitte persönlich Ihre PatientInnen über den Terminausfall und vereinbaren Sie – wenn möglich / absehbar einen neuen Termin. Bei Bedarf weisen Sie auf die im Erstkontakt mit dem/der PatientIn besprochenen stationären und ambulanten Notfalleinrichtungen hin. Im Falle einer längeren Krankheitsphase oder einer Schwangerschaft mit anschließender Elternzeit besprechen Sie bitte zeitnah mit Ihren PatientInnen Vertretungsmöglichkeiten durch ihre/n SupervisorIn oder öffentliche Versorgungsangebote für Notfälle, in seltenen Ausnahmefällen auch durch eine andere WeiterbildungskollegInnen.
Um Ihre PatientInnen auch von ihrem zu Hause aus über den Ausfall einer Behandlungsstunde aufgrund von Krankheit oder anderen nicht vorhersehbaren Anlässen informieren zu können, sollten Sie sich überlegen, wo Sie zu Hause diese sensiblen PatientInnendaten aufbewahren, damit Sie nicht von Dritten zugänglich/einsehbar sind, Ihnen aber für diesen Fall dennoch zur Verfügung stehen. Es empfiehlt sich ein abschließbarer Rollcontainer oder Aktenschrank.
Terminvergabe und Notfall-Termine
Die Art der Terminvergabe regelt jede/r AusbildungskollegIn individuell. Die in der Ambulanz tätigen AusbildungskollegInnen verpflichten sich mit Beginn ihrer praktischen Ausbildung, Möglichkeiten für Krisen- oder Notfallsituationen (also Termine) in Ihrem Wochenplan einzuplanen, um kurzfristig in solchen Fällen Krisengesprächstermine vergeben zu können.
Wechsel des/der BehandlerIn
Ein Wechsel während einer schon bewilligten, laufenden Therapie sollte besonders gut supervisorisch besprochen sein. Dies wäre ein höchst unwahrscheinlicher Fall. Hier liegt es in der Verantwortung von WeiterbildungskollegInnen und SupervisorInnen eine konstruktive Weiterführung des Prozesses zu ermöglichen. Bitte informieren Sie die Ambulanzleitung in einem solchen Fall.
Therapieende oder -abbruch
Die Beendigung einer Therapie wird über die Ziffern 88130 oder 88131 im Rahmen der Abrechnung an die Krankenkasse mitgeteilt.
Es ist möglich von den bewilligten Stunden je nach Länge der Therapie bis zu 16 Stunden für eine Rezidivprophylaxe zu nutzen. Dies können Sie bereits bei der Beantragung auf dem PTV2 angeben. Bei Ende der Therpie mit Rezidivprophylaxe (über die Ziffer 88131) können Sie die verbliebenen Stunden innerhalb eines Zweijahreszeitraums nutzen.
Schweigepflicht #
Es ist wichtig, dass Sie Ihre PatientInnen zu Beginn der Therapie über die Schweigepflicht gemäß § 8 der (Muster) Berufsordnung für Psychologische PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInne (die Berufsordnung der ÄrztInnen und dort fixierte „Ärztliche Schweigepflicht“ ist als Grundlage für diese Formulierung als gleichermaßen gültig anzusehen), ausführlich aufklären.
Die Schweigepflicht gilt auch innerhalb der gesamten Ambulanz, also auch innerhalb der Supervision, d.h. in der Supervision Besprochenes darf den Raum nicht verlassen. Generell gilt, dass auch im Rahmen kollegialer Beratung, Intervisionen oder Supervisionen Informationen über PatientInnen und Dritte nur in anonymisierter Form verwendet werden dürfen.
Bitte achten Sie darauf, dass innerhalb der Behandlungsräume und auch im privaten Umfeld die Intimsphäre der PatientInnen gewahrt wird. Dies bedeutet u. a., dass
- PatientInnenakten nicht für unbefugt Dritte einsehbar sein dürfen.
- Gespräche nur in klar von anderen Räumen der Praxen, wie z. B. Privat- und Warteräumen, abgegrenzten Behandlungsräumen stattfinden.
- Die Behandlungsräume dürfen optisch und akustisch nicht durch Dritte einsehbar sein.
- Telefonate im Beisein von PatientInnen werden so geführt, dass die Identität des Anrufenden nicht offenbart wird.
Juristisch ist die Ambulanzleitung (MSc. Charlott O‘Boyle) der Behandler. Er delegiert die Behandlungen an die Supervisoren und Ausbildungskollegen. Die Ambulanzleitung wird im Ergänzungsermächtigungsvertrag nach § 117 SGB V in dieser Funktion benannt, rechnet mit den Krankenkassen ab und steht für Regresse und Behandlungsfehler ein. Insofern ist sie unmittelbar in jede Behandlung einbezogen. Die Ambulanzleitung hat einen Rechtsanspruch auf Mindestinformationen am Untersuchungs- oder Behandlungsende, auch wenn der/die PatientIn dies nicht will.
Bitte informieren Sie Ihre PatientInnen zu Beginn der Behandlung mündlich darüber, dass Ihre Behandlungsstammdaten (u. a. Name, Kasse, Diagnose, Therapieverlauf) sowie der Erst- und Folgeberichte an die Institutsambulanzleitung zur Archivierung weitergegeben werden und 10 Jahre verschlossen aufbewahrt werden, danach jedoch vernichtet werden.
Es ist wichtig, dass die Sie Ihre PatientInnen darüber informieren, dass diese Daten nur den AmbulanzmitarbeiterInnen, die der Schweigepflicht unterliegen, zugänglich und nicht von unbefugten Dritten einsehbar sind. Die PatientInnen müssen sich hierfür mündlich (machen Sie sich in jedem Fall eine Kurznotiz in die PatientInnenakte!) oder schriftlich im Rahmen des Therapievertrags vor Therapiebeginn einverstanden erklären. Im Sinne der Aufklärungspflicht ist es unerlässlich, Ihre PatientInnen auf diesen Sachverhalt hinzuweisen.
Grenzen der Schweigepflicht
Bitte weisen Sie Ihre PatientInnen und/oder deren Eltern auch auf mögliche Grenzen der Schweigepflicht hin. Liegt insbesondere eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung des/der PatientIn vor, so gibt ebenfalls § 8 der (Muster-) Berufsordnung für Psychologische PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen vor, eine Unterscheidung bzw. Abwägung zwischen Schweigepflicht, Schutz des/der PatientIn und Schutz von Dritten bzw. des Allgemeinwohls zu treffen.
Auch vergangene Straftaten unterliegen der Schweigepflicht, dürfen also nicht der Polizei gemeldet werden. Angekündigte Straftaten sind bei „Fremdgefährdung“ dagegen den Behörden zu melden.
TherapeutInnen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sind schweigepflichtig sowohl gegenüber dem einsichtsfähigen PatientInnen als auch gegebenenfalls gegenüber den am therapeutischen Prozess teilnehmenden Bezugspersonen hinsichtlich der von den jeweiligen Personen Ihnen anvertrauten Mitteilungen. Es gelten die Ausnahmen entsprechend den gesetzlichen Regelungen. Das bedeutet, Eltern erfahren keine konkreten Inhalte aus der Therapie des Kindes und Kinder nichts aus den Gesprächen mit den Eltern. Ausnahmen erfolgen nur mit (schriftlicher) Genehmigung des jeweils Betroffenen. TherapeutInnen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bewegen sich somit in einem Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmungsrecht des Kindes und dem Elternrecht.
Eltern werden in den Therapieprozess einbezogen, wenn es für die Behandlung förderlich ist. Deshalb sollten Sie mit dem Kind oder dem Jugendlichen sorgfältig besprechen, welche Themen in den Gesprächen mit den Eltern angesprochen werden dürfen. Sind Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen gewünscht, dürfen diese nur mit (schriftlicher) Einwilligung des/der PatientIn erfolgen. Über die Weitergabe von Informationen müssen der/die PatientIn und die sorgeberechtigten Eltern immer informiert werden.
Nach der herrschenden Rechtsmeinung können auch Minderjährige wirksam über die Entbindung von der Schweigepflicht entscheiden (z. B. bei einem Gerichtsverfahren, in dem die Eltern den/die TherapeutIn von der Schweigepflicht entbunden haben, das Kind dies aber nicht möchte), wenn das Kind oder der/die Jugendliche die Bedeutung seiner Erklärung im Hinblick auf seine Geheimhaltungsinteressen begreifen kann.
Schweigepflichtsentbindung
Bitte klären Sie Ihre PatientInnen auch über die Möglichkeit der Schweigepflichtsentbindung gegenüber Dritten z. B. gegenüber dem/der behandelnden Arzt/Ärztin auf. Bitte achten Sie immer darauf, dass Sie diese Einwilligung schriftlich festhalten. Dies bedeutet, dass vor jedem Einbezug von Dritten (z. B. für ein Telefonat mit behandelnden Ärzten) eine Schweigepflichtsentbindung des/der PatientIn vorliegen muss. Wichtig ist auch, dass in Berichten selbst, im Konsiliarbericht und in beigefügten Klinikberichten alle persönlichen Angaben des/der PatientIn unkenntlich gemacht werden.
Schweigepflichtentbindung an APH
Schweigepflichtentbindung für APH
Bei der Psychotherapie mit Kindern- und Jugendlichen beachten Sie bitte folgende rechtliche Bestimmungen:
Jugendliche gelten ab dem vollendeten 15. Lebensjahr als eigenständig versichert, trotz Mitversicherung bei dem Hauptmitglied der gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb können diese Jugendlichen selbst einen Antrag auf Psychotherapie ohne Mitwirkung bzw. Unterschrift der Eltern stellen, wobei die Eltern vom Leistungsträger/PsychotherapeutIn informiert werden sollten. Die Schweigepflicht ist in diesem Punkt aufgehoben. Ist der/die mind. 15-jährige Jugendliche jedoch mit seinen/ihren Eltern in der privaten Krankenversicherung oder über die Beihilfe versichert, kann nur der/die Hauptversicherte den Antrag auf Übernahme der Kosten der Psychotherapie stellen.
Jede psychotherapeutische Behandlung bedarf der Einwilligung des/der PatientIn. Voraussetzung für die Behandlung ist also eine wirksame Einwilligungsfähigkeit des/der ErklärendIn. Diese ist nicht von der Geschäftsfähigkeit, sondern allein von der natürlichen Einsichts- und Willensentscheidung des Kindes bzw. des Jugendlichen abhängig. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kommt es darauf an, ob der/die Minderjährige „nach seiner geistigen und sittlichen Reife die Bedeutung und die Tragweite der Therapie und seiner Gestaltung zu ermessen vermag“ (BGHZ 29, 33, 36).
Zu beachten gilt aber, dass beide Elternteile informiert werden bzw. ihre Zustimmung zur Psychotherapie geben müssen (Bestimmung ergibt sich aus dem KJHG). Dies gilt auch für Eltern, die in Trennung oder Scheidung leben und über das gemeinsame Sorgerecht verfügen. In Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, ist gegenseitiges Einvernehmen der Erziehungsberechtigten erforderlich (§ 1687 Abs. 1 BGB). Das Elternteil, bei dem das Kind sich gewöhnlich aufhält, darf in Angelegenheiten des täglichen Lebens allein entscheiden, hierzu zählen im gesundheitlichen Bereich die Behandlung leichter Erkrankungen und die tägliche Gesundheitsversorgung, nicht aber die Psychotherapie. Verweigert ein sorgeberechtigtes Elternteil die Zustimmung zur Psychotherapie, kann die Behandlung erst nach einer gerichtlichen Entscheidung durchgeführt werden.
Patientenakte und Akteneinsicht #
Es wird erwartet, dass alle KollegInnen in Aus-/Weiterbildung eine adäquate Dokumentation ihrer PatientInnenbehandlungen führen, die die Kontinuität der Versorgung und einen jederzeit aktuellen Überblick und ggf. einen haftungsrechtlichen Nachweis gewährleistet. Diese Akte sollte nach geltender Datenschutzgrundverordnung i. d. R. in einem verschließbaren Stahlschrank aufbewahrt werden. In der Geschäftsstelle der APH-Akademie steht Ihnen dazu ein Stahlschrank zur Verfügung. Sie werden jedoch für Supervision und Fallseminare die Akte häufiger bei sich führen. Gehen Sie daher sehr sorgsam mit den Aufzeichnungen um und führen ggf. nur Kopien oder die wirklich notwendigen Schriftstücke bei sich (und keine Kostenzusagen, Antragsformulare, etc.). Sie können auch geeignete andere Standorte für die Akten nutzen.
Die Patientenakte
Für jede/n PatientIn mit dem eine Behandlung begonnen wurde, müssen Sie eine eigene, namentlich gekennzeichnete, systematisch geordnete PatientInnenakte anlegen. In dieser Akte sollten ausreichend patientInnenbezogene Informationen zur Diagnose, Anamnese, Therapieplanung und Therapieverlauf sowie Aspekte der Therapeuten – Patientenbeziehung dokumentiert werden, anhand derer die PatientInnen zu identifizieren sind. Außerdem sollte die Akte Kopien bzw. alle angeforderten Befundberichte Dritter (z. B. Konsiliarbericht, stationäre Entlassungsberichte) enthalten. Kurze Telefonate, Indikationsstellung, Antragsformulare, Berichte (an GutachterInnen oder bei KZT für die SV), Ausfall-Honorarregelung, Aufklärungsdokumente sollten in der PatientInnenakte zu finden sein. Die PatientInnenakten können handschriftlich, „ausgedruckt“ oder auch elektronisch auf einem Passwort geschützten PC angelegt werden (die Abrechnungssoftware Elefant bietet hier „Vorlagen“. Wichtig ist, dass jede Behandlungsstunde mindestens mit folgenden Angaben dokumentiert wird:
- Datum sowie kurze Stichworte zu:
- Themen / Inhalte und psychotherapeutische Maßnahmen/Interventionen,
- Beziehungsdiagnostik (ging der/die PatientIn z. B. erleichtert aus der Stunde),
- Abklärung der Stimmung des/der PatientIn (akute Suizidalität?) sowie (je nach Situation)
- weitere (neue) Ergebnisse psychometrischer Erhebungen
- weitere (neue) anamnestische Daten,
- geänderte Diagnose,
- (neue) Therapieplanung oder Ziele,
Es empfiehlt sich, in der PatientInnenakte einen Hefter mit der allgemeinen Behandlungsdokumentation und einen Hefter mit Ihren subjektiven Aufzeichnungen anzulegen. Durch diese Trennung wird ermöglicht, sich teilweise von der Akteneinsicht (s. u.) zu schützen. Hinweise und Anregungen zur Verlaufsdokumentation finden Sie auch auf der Seite der PsychotherapeutInnenkammer Hamburg.
Patientenrecht auf Akteneinsicht
Alle PatientInnen haben grundsätzlich eine uneingeschränkte Akteneinsicht in ihre Behandlungsakte (also auch in den Antrag an den/die GutachterIn). Der/die PatientIn kann die Akteneinsicht in den Praxisräumen nehmen oder Kopien der Behandlungsunterlagen und –Aufzeichnungen auf eigene Kosten erbitten. Einsichtsberechtigt ist der/die PatientIn oder ein/e bevollmächtigte/r Dritte/r mit Vorlage einer schriftlichen Vollmacht.
Am 1. Januar 2013 ist das Patientenrechtegesetz in Kraft getreten, in dem einige Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Sozialgesetzbuches V sowie die Rechtsprechung zusammengeführt werden, um Transparenz und Rechtssicherheit für PatientInnen im Gesundheitssystem zu verbessern.
Es wird gesetzlich geregelt:
- das Behandlungs- und Arzthaftungsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verbunden mit einer Beweislastumkehr zugunsten des/der PatientIn
- die Förderung einer Fehlervermeidungskultur
- die Verfahrensrechte bei Behandlungsfehlern verbunden mit Ansprüchen der PatientInnen bei Behandlungsfehlern und einer Beweislastumkehr
- die Rechte gegenüber LeistungsträgerInnen, also auch den psychotherapeutischen Praxen aber auch gegenüber den Krankenkassen
- die Aufklärungspflicht gegenüber PatientInnen
- das Einsichtsrecht von PatientInnen in die Behandlungsakte
- die PatientInnenbeteiligung
Daraus ergeben sich für Praxen und Ambulanzen neue Verpflichtungen, auf die wir uns in unserer Arbeit mit PatientInnen einstellen müssen, auch wenn das Gesetz nicht auf psychotherapeutische Praxen zugeschnitten ist und Bemühungen der Bundespsychotherapeutenkammer und der Verbände um stärkere Berücksichtigung psychotherapeutischer Belange vergeblich waren.
Das bedeutet für unsere Arbeit:
Der/die PatientIn muss umfassend vor der Behandlung im persönlichen Gespräch aufgeklärt werden über Art und Umfang der Behandlung sowie deren Risiken und Nebenwirkungen. Schriftliche Informationen allein reichen nicht aus. Die Dokumentation der erbrachten Leistung muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang erfolgen. Die Aufzeichnungen müssen manipulationssicher sein, d. h. spätere Veränderungen müssen erkennbar bleiben.
Schon nach der früheren Rechtsprechung galt das Einsichtsrecht auch für subjektive Aufzeichnungen des/der PsychotherapeutIn als Teil der PatientInnenakte. Sie müssen dem/der PatientIn auf Verlangen zugänglich gemacht werden, sofern nicht erhebliche therapeutische Gründe (erhebliche Gefahren für den/die PatientIn) dagegensprechen. Dies muss aber gut begründet dargelegt werden.
Das Bundesverfassungsgericht hielt in diesem Punkt eine Schwärzung von subjektiven Aufzeichnungen für gerechtfertigt. Allerdings habe der/die PatientIn das Recht, sich selbst zu schädigen, so ein Urteilsspruch. Geschwärzt werden dürfen bzw. müssen Passagen, die schutzwürdige Belange von Dritten betreffen. Das können z. B. Mitteilungen sein, die von einem Elternteil im Rahmen der Begleitgespräche gemacht werden.
Bedauerlicherweise wurde das Einsichtsrecht von Erziehungsberechtigten in die Akten von Minderjährigen ebenso wenig geregelt wie deren Einwilligungsfähigkeit.
Dem/der PatientIn sei „unverzüglich“ Einblick in die Akten zu gewähren (ggf. in der nächsten Sitzung). Kopien der Akten können angefordert werden und müssen gegen angemessene Gebühr übergeben werden.
Dokumentationspflicht und Datenschutz #
Nach § 9 der (Muster-) Berufsordnung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten unterliegen alle PsychotherapeutInnen und somit auch alle AusbildungskollegInnen der Dokumentationspflicht. Dies bedeutet, dass jede psychotherapeutische Behandlung in der PatientInnenakte mit mindestens dem Datum, anamnestische Daten, Diagnose, Fallkonzeptualisierungen, psychotherapeutische Maßnahmen/Interventionen sowie gegebenenfalls Ergebnisse psychometrischer Erhebungen notiert sein müssen.
Dokumentationspflicht
Eine fehlerhafte oder unterlassene Dokumentation zu Behandlungsfehlern in der Therapie kann sich, wenn der/die AusbildungskollegIn Behandlungsinhalte, -ziele oder –ergebnisse nicht ausreichend erinnert bzw. verfolgt, auf die Behandlungsqualität niederschlagen. Für alle PsychotherapeutInnen, somit (eingeschränkt) auch für AusbildungskollegInnen, besteht bei Behandlungsfehlern aufgrund fehlerhafter oder unterlassener Dokumentation somit eine erhebliche Haftungsgefahr.
Die fehlerhafte oder unterlassene Dokumentation führt im Haftungsprozess regelmäßig zur Beweislastumkehr für den/die PatientIn. Kann der/die TherapeutIn bzw. WeiterbildungskollegIn nämlich den behaupteten Verlauf und die therapeutischen Maßnahmen nicht ordnungsgemäß aufgrund der Dokumentation nachweisen, so hat er/sie gegenüber der Geltungsmachung von Behandlungsfehlern nun mehr umgekehrt nachträglich eine fehlerfreie Behandlung zu beweisen, was bei „Aussage gegen Aussage“ schwierig werden kann. D.h. nur eine vollständige und gewissenhafte Dokumentation erlaubt dem/der TherapeutIn bzw. dem/der AusbildungskollegIn den Nachweis, dass ein Behandlungsfehler nicht vorlag, sodass der/die PatientIn hierfür beweisbelastet bleibt und seinerseits bei „Aussage gegen Aussage“ die Beweislast trägt.
Datenschutz
Im Sinne der allgemeinen Datenschutzbestimmungen und jetzt auch in Bezug auf die neue europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) muss der Schutz von PatientInnendaten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unbefugtem Zugang oder Gebrauch durch Dritte gewährleistet sein. PatientInnenbezogene Daten müssen somit an einem für unbefugte Dritte nicht zugänglichen und vor äußeren Einflüssen (z. B. Nässe) sicheren Ort aufbewahrt werden. Durch die Unterzeichnung der Einverständniserklärung zur Einhaltung der Qualitätsstandards des vorliegenden Handbuchs (siehe Anfang) erklären Sie sich bereit, die Datenschutz- und Schweigepflichtsbestimmungen in ihrer Arbeit zu berücksichtigen. Die Pflicht zur Verschwiegenheit über alle Sachverhalte, die im Zusammenhang mit der Ambulanz zur Kenntnis gelangen, insbesondere aber über PatientInnen betreffende Belange, gilt zeitlich unbegrenzt!
Elektronische Daten sind zur Wahrung des Datenschutzes im EDV – System entsprechend § 10 Abs. 2 der (Muster-) Berufsordnung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zugriffsrechtlich durch Passwörter bzw. durch den Einsatz von Verschlüsselungsprogrammen und Firewalls zu sichern. Sie sind verpflichtet, eigenverantwortlich darauf zu achten, dass Computerbildschirme und PatientInnenunterlagen nicht von Unbefugten einsehbar sind. Außerdem sind Sie eigenverantwortlich für die Sicherung Ihrer PC – gestützten Daten zuständig.
Interne und externe Datenübermittlung
Die Übermittlung der Abrechnungsdaten für die Quartalsabrechnung erfolgt auf einem Datenträger. Entweder erstellen Sie eine CD (dies ist noch immer so in der Software so vorgegeben) oder Sie speichern die Daten auf einem USB-Stick. Diesen USB-Stick statten Sie bitte mit einem Namensschild aus und reichen Ihn zusammen mit den weiteren Abrechnungunterlagen (elefant Kurzbericht) in einem geschlossenen Umschlag in der Geschäftsstelle ein. Nach erfolgter Abrechnung erhalten Sie ihn in ihr Fach zurück.
Die PatientInnenakten geben Sie bitte ausschließlich digital in der Geschäftsstelle am Ende der Behandlung oder spätestens am Ende der Aus-/Weiterbildung ab (bitte in einem geschlossenen Umschlag in das Fach „Ambulanz“ legen). Scannen Sie ggf. notwendige Dokumente dazu ein. Die Daten werden auf einem mit Passwort und Firewall geschützten PC bzw. in Zukunft auch in einer nach DGSVO geeigneten Cloud (Passwortgeschützt und auf EU-Servern) nach jeweils aktuellem Stand „sicher“ abgelegt. Die Datenträger (z.B. Stick) werden gelöscht zurück in ihr Fach/an Sie gegeben, bzw. sachgerecht vernichtet (z.B. CD).
PatientInnendaten, z. B. nachdem Sie PatientInnen von der Warteliste angefordert haben, erfolgen nicht per E-Mail sondern in Form von gedruckten Dokumenten und in ihr Fach, welches in einem abschließbaren Stahlschrank ist.
Die externe Datenübermittlung (also die Weitergabe von PatientInnendaten an eine/n behandelnde/n Arzt/Ärztin, einer Klinik etc.) erfolgt nur nach schriftlicher Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn und entsprechender Dokumentation in der PatienInnennakte oder auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen. Ohne das Vorliegen einer schriftlichen oder einer dokumentierten mündlichen Schweigepflichtsentbindung dürfen PatientInnenunterlagen grundsätzlich nicht weitergereicht werden. Von den insgesamt vorliegenden Unterlagen oder Befunden werden nur diejenigen weitergeleitet, die zur Klärung angefragter Sachverhalte erforderlich sind. In der PatientInnenakte wird dokumentiert, welche Unterlagen in Kopie weitergeleitet wurden. Von eigens für die Weiterleitung erstellten Materialien, z. B. Befundmitteilungen, sollte eine Kopie in der PatientInnenakte abgeheftet werden. In der Regel sollte die Weiterleitung der Unterlagen auf dem Postweg erfolgen. Falls zur Beschleunigung der Weiterleitung noch ein Faxgerät eingesetzt wird, sollte die Übermittlung unmittelbar vor der Aussendung telefonisch avisiert werden, um zu verhindern, dass PatientInnenunterlagen unbemerkt im Faxeingang des Empfängers liegen. Eine Übermittlung per Email ist gemäß dem Datenschutzbeauftragten der APH, Herrn T. Pudelko unter bestimmten Bedingungen möglich. Es muss ein Passwortschutz für das Dokument eingerichtet werden. Das Passwort wiederum müsste auf einem anderen „Kanal“ als Email, also z. B. per Anruf, Fax oder SMS zum Empfänger gelangen.
Aufbewahrungspflicht der Patientendokumente
Die Dokumentationen müssen zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung, soweit sich nicht aus gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsdauer ergibt, an einem für unbefugte Dritte nicht zugänglichen, ausreichend vor Diebstahl gesicherten Ort aufbewahrt werden.
Diagnostik #
Die wichtigste Quelle der Diagnosefindung stellt das psychotherapeutische Gespräch und die Befragung der PatientInnen dar. Alle Maßnahmen zur Erstellung der Diagnostik müssen zeitnah, also direkt im Anschluss an die Sitzung oder spätestens im Verlaufe des Tages dokumentiert werden, damit Sie einer eventuellen rechtlichen Beweiskraft standhalten kann. Überlegungen zur Verdachts- und Differentialdiagnostik sowie die endgültige Diagnose sollten Sie ausführlich und zeitnah mit dem/der SupervisorIn besprechen und in der PatientInnenakte dokumentieren.
Der soziale, psychische und körperliche Befund
Zur Diagnoseerstellung müssen Sie in den probatorischen Sitzungen den sozialen, psychischen und körperlichen Befund erheben.
Zudem sollte eine Einschätzung der Suizidalität erfolgen. Besondere Sorgfalt sollten Sie auf die Dokumentation von suizidalen Krisen legen. Neben der Aufzeichnung der diagnostischen Maßnahmen, die zur Abklärung der Ernsthaftigkeit der suizidalen Absichten durchgeführt werden, sollten Sie deshalb insbesondere auch dokumentieren, welche Maßnahmen Sie zur Verhinderung eines geplanten Suizids getroffen haben. Darüber hinaus sollten Bewusstseinsstörungen, Wahnsymptome oder andere psychopathologische Auffälligkeiten sowie Absprachefähigkeit, Introspektionsfähigkeit, Therapiefähigkeit (Motivation, Veränderungsbereitschaft) und der Leidensdruck des/der PatientIn erfasst und in der PatientInnenakte dokumentiert werden. Insbesondere sollten Sie auf Antrieb, Denken, Affekte und Verhalten eingehen.
Hinweise auf Gewalt oder Vernachlässigung
Bitte seien Sie alle – sowohl im Erwachsenen- als auch speziell im Kinder- und Jugendlichenbereich – aufmerksam für Hinweise auf Vernachlässigung oder Missbrauch Ihrer PatientInnen. Bei Verdacht auf Vernachlässigung oder Missbrauch sollten Sie zunächst mit Ihrem/Ihrer SupervisorIn sprechen, um dann ggf. weitere Schritte mit entsprechender institutioneller Unterstützung z. B. durch die Kriminalpolizei, das Jugendamt, den Kindernotdienst, den Kinderschutzbund und Frauenhäusern einleiten zu können. Bitte besprechen Sie vor Aufnahme Ihrer praktischen Ausbildung mit Ihren SupervisorInnen auch, wie sie in Notsituationen erreichbar sind, um Sie um Unterstützung bitten zu können!
Bei manchen PatientInnen kann es in Rücksprache mit Ihrem/Ihrer SupervisorIn sinnvoll sein, einen Notfallplan zu erarbeiten. Diesem „Notfallplan“ können Sie in Notsituationen (z. B: eine Frau berichtet von häuslicher Gewalt und äußerst eindeutig, dass Sie heute nicht mehr dorthin zurück möchte) erste Telefonnummern von entsprechenden Beratungsstellen entnehmen.
Der Konsiliarbericht #
Gemäß der Psychotherapie-Richtlinien muss jede/r psychologische PsychotherapeutIn oder KJP – PsychotherapeutIn (und somit auch alle AusbildungskollegInnen) im Verlaufe der probatorischen Sitzungen und spätestens vor der Beantragung der Kostenübernahme der Psychotherapie durch die Krankenkasse den PatientInnen gezielt an den/die behandelnde/n Arzt/Ärztin zur Erstellung eines körperlichen Befundes (Konsiliarbericht) verweisen.
Alle notwendigen Informationen wie z. B. eine Kurzanamnese und eine Verdachtsdiagnose für den /die Arzt/Ärztin können Sie in einer Überweisung (Anhang..KV-Muster) an diesen übermitteln. Der/die Arzt/Ärztin erstellt nach persönlicher Untersuchung des/der PatientIn den Konsiliarbericht und übermittelt ihn zeitnah, spätestens nach 3 Wochen an Sie zurück. Oft geschieht dies durch eine Übergabe über den/die PatientIn selbst.
Bitte beachten Sie, dass die Rücksendung des Konsiliarerichtes i.d.R. an die APH erfolgt, da diese Adresse auf Ihrem Stempel angegeben ist. Hier erhalten Sie diesen in ihr Fach – genauso wie die Stellungnahme des/der Gutachters/Gutachterin zu Ihrem Gutachtenantrag.
Auskunftspflichten #
Nach § 100 Abs. 1 SGB X sind alle Angehörigen eines Heilberufes (und damit auch Sie als AusbildungskollegIn) verpflichtet, dem Leistungsträger im Einzelfall auf Verlangen Auskunft zu erteilen, soweit es für die Durchführung von dessen Aufgaben nach dem Gesetz erforderlich und gesetzlich zugelassen ist. Dafür muss eine Schweigepflichtsentbindung des/der PatientIn vorliegen.
| Anfragende
Stelle |
Voraussetzung für die Auskunftspflicht des Vertragsarztes | Vergütung |
| Krankenkassen | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn
Die Bundesmantel- und Ersatzkassenverträge regeln ergänzend zu den gesetzlichen Grundlagen die Modalitäten zur Auskunftserlaubnis und -verpflichtung gegenüber den Krankenkassen. Danach ist der/die Vertragsarzt/-ärztin befugt und verpflichtet, der Krankenkasse für ihre gesetzlichen Aufgaben Auskünfte zu erteilen sowie Bescheinigungen, Zeugnisse, Berichte und Gutachten zu erstellen (s. § 36 Abs. 1 (BMV-Ä)/PK; § 6 Abs. 3 BMV-Ä/EK). Für Auskünfte an die Krankenkassen sind grundsätzlich Vordrucke vereinbart und zu verwenden. Anfragen auf vereinbarten Vordrucken müssen beantwortet werden, so zum Beispiel Psychotherapievordrucke gemäß § 15 Psychotherapie-Vereinbarung (Formblätter zum Antrag) Krankenkassen können auch Informationen auf nicht vereinbarten Vordrucken einfordern, müssen hierbei jedoch die Rechtsgrundlage für die Auskunftspflicht angeben. Ohne sind Sie nicht verpflichtet zu antworten. Gleiches gilt auch für die Forderung von ausführlicheren Auskünften. |
Vordrucke: EBM-GNR. 01620 ff.
Nach Ansicht der KBV nicht nach EBM berechenbar. Sollte Ver- gütung nach GOP mit KK vereinbart werden. |
| MDK | Zum Teil schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn
Bei Anforderungen vom MDK muß in jedem Fall mitgeteilt werden, dass der/die PatientIn formal in der Institutsambulanz in psychotherapeutischer Behandlung ist, wie viele Stunden genehmigt sind, welche Leistungen erbracht werden und unter welcher Diagnose. Der/die PatientIn hat dies gegenüber der Krankenkasse schon unterschrieben und damit alle BehandlerInnen schon von der Schweigepflicht entbunden. Andernfalls könnte der/die Pat. Schwierigkeiten mit seiner/ihrer Kasse bekommen. Auskunftspflicht gegenüber MDK ist gesetzlich festgelegt im Rahmen der Aufgaben des MDK, zu medizinischen Fragen, im Auftrag der KK gutachterlich Stellung zu nehmen (§ 275 Abs. 1-3 SGB V ) Auskunftsverpflichtung beruht auf § 276 Abs. 2 SGB V; Umfang grds. durch Prüfauftrag begrenzt. § 73 des SGB V besagt, dass die Psychologischen PsychotherapeutInnen keine Feststellung und Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit vornehmen dürfen. Wenn es um Fragen der Arbeitsunfähigkeit geht, sind wir nach dieser Regelung von der Ausstellung von Bescheinigungen und Erstellung von Berichten für den Medizinischen Dienst befreit. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu wissen, dass es dem MDK nach § 275 Abs. 5 SGB V untersagt ist, in die Behandlung einzugreifen. Auskünfte zur Arbeitsfähigkeit eines/einer PatientIn während einer laufenden Behandlung geben zu müssen, kann das notwendigen Vertrauen zwischen dem/der PatientIn und dem/der TherapeutIn sehr leicht beeinflussen und den Therapieerfolg gefährden. Für ausführliche Berichte an den MDK ist ein Vordruck vereinbart (Muster 11). Begehrt der MDK Auskünfte auf einem nicht vereinbarten Vordruck, so muss er die Rechtsgrundlage für seine Anfrage und die Auskunftspflicht der PsychotherapeutInnen angeben. Er muss auch angeben, zu welchem Zweck er die erbetene Auskunft im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung benötigt. |
Vordruck 11: EBM-GNR. 01621
Hier sollte Vergütung nach GOP mit MDK vereinbart werden. |
| Kassenärztliche
Vereinigung (KV) |
Gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung besteht die Auskunftspflicht auch ohne die Schweigepflichtentbindung durch den/die PatientIn. Die Satzung der KV enthält Formulierungen, nach denen deren Mitglieder verpflichtet sind, die KV unverzüglich nach Aufforderung alle Auskünfte zuerteilen und die erforderlichen Unterlagen beizubringen, die die KV Durchführung ihrer Aufgaben benötigt. | |
| Rentenversicherungsträger | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn
Erforderlichkeit der Auskunft zur Aufgabenerfüllung |
JVEG[1]i
(Anlage 2 zu § 9) in Verbindung mit § 21 Abs. 3 SGB X |
| Unfallversicherungsträger | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn
Gesetzliche Pflicht nach §§ 201 u. 203 SGB VII zur Auskunftserteilung über Zustand, die Behandlung, sowie über frühere Erkrankungen des/der VersichertIn § 46 Vertrag Ärzte / Unfallversicherungsträger (Einwilligung des/der PatientIn nicht erforderlich) Fristen für die Erfüllung der Verpflichtungen nach § 49 des Vertrages Ärzte/Unfallversicherungsträger für Berichte und Gutachten längstens 8 Tage |
Vereinbartes Gebühren-verzeichnis: (UV-GOP) |
| Sozialämter | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn
§ 38 Abs. 4 BSHG Auskunftspflicht des Vertragsarztes entsprechend den für Krankenkassen geltenden Regelungen Regelung im Vertrag zwischen der KVSH und dem S.-H. Landkreistag § 3 Abs. 2, sowie Protokollnotiz zum Vertrag; Bezugnahme auf BMV-Ä Bei Verwendung nicht vereinbarter Vordruckmuster: Erforderlichkeit der Auskunft zur Aufgabenerfüllung |
Vereinbarte Vordrucke: Erstattung von Auslagen
Nicht vereinbarte Vordrucke: EBM-GNR 01620 |
| Arbeitsämter | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn
Erforderlichkeit der Auskunft zur Aufgabenerfüllung |
JVEG (Anlage 2 zu § 9) in Verbindung mit § 21 Abs. 3 SGB X |
| Versorgungsämter | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn
Erforderlichkeit der Auskunft zur Aufgabenerfüllung |
JVEG (Anlage 2 zu § 9) in Ver-bindung mit § 21 Abs. 3 SGB X |
| Gesundheitsämter | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn
Erforderlichkeit der Auskunft zur Aufgabenerfüllung Ergänzung: Meldepflicht von Krankheiten i. S. d. § 6 Infektionsschutzgesetz |
Anfragen: JVEG (Anlage 2 zu § 9) in Verbindung mit § 21 Abs. 3 SGB X (Erfüllung der Meldepflicht: Aufwendungs-ersatz) |
| Gerichte | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn | JVEG Anlage 2 zu § 9) in Verbindung mit § 21 Abs. 3 SGB X |
| Patienten/ Rechtsanwälte | Einsichtsrecht des/der PatientIn in Behandlungsunterlagen
Schriftliche Vollmachtserteilung an eine/n Rechtsanwalt/-anwältin zur Einsichtnahme in PatientInnenunterlagen |
Kosten-erstattung (Porto/Kopien) |
| Arbeitgeber | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn | GOÄ Nr. 70ff. |
| Reha- Einrichtungen | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn
Rechtsgrundlage § 73 I b Satz 3 SGB V (andere Leistungs-erbringer) |
GOÄ Nr. 70ff |
| Private Versicherung | Schriftliche Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) des/der PatientIn | GOÄ Nr. 70 ff. |
|
Ausfallhonorar #
PsychotherapeutInnen arbeiten üblicherweise nach dem Bestellsystem, d.h. dass Termine für einen längeren Zeitraum vereinbart werden. In diesem Zusammenhang kommt es leider immer wieder vor, dass PatientInnen kurzfristig Termine absagen.
Es ist daher wichtig, dass Sie sich vor Therapiebeginn überlegen, wie Sie im Falle von Terminabsagen verfahren möchten. Nach der ständigen Rechtsprechung ist es zulässig, im Falle eines Bestellsystems, bei dem kurzfristige Terminumlegungen und damit die Kompensation von Einnahmeausfällen nur schwer möglich sind, ein privat zu erstattendes Ausfallhonorar für Terminabsagen einzufordern. Im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung muss der/die TherapeutIn aber nachweisen, dass er/sie die Zeit nicht für andere Arbeiten nutzen können, was schwierig sein dürfte.
Sie haben so die Möglichkeit, mit dem/der PatientIn gemeinsam zu vereinbaren, dass für alle Terminabsagen, die nicht innerhalb eines Zeitraumes von 48 Stunden (oder innerhalb eines anderen, Ihnen sinnvoll erscheinenden Zeitraumes) vor dem regulär vereinbarten Therapietermin mitgeteilt werden, dieses Ausfallhonorar verlangt wird.
Können Sie allerdings diesen Termin durch eine/n andere/n PatientIn oder durch Bürotätigkeiten (z. B: Schreiben eines Gutachtenantrages oder Aktualisierung Ihrer PatientInnenakten) belegen, so dürfen Sie dieses Honorar nicht einfordern! Sie müssen auch im Therapieraum anwesend sein.
Ihren PatientInnen gegenüber lässt sich eine solche Ausfallhonorar-Vereinbarung mit dem Hinweis begründen, dass innerhalb eines Zwei-Tage-Zeitraumes die Terminumlegung nur noch schwer möglich ist, die laufenden Praxiskosten aber dennoch zu finanzieren sind und der ausgefallene Termin nicht mit der Kasse abgerechnet werden kann. Es können auch Ausnahmen von dieser Regelung (z. B. Unfall, unvorhersehbare Ereignisse) vereinbart werden, sind aber generell nach der Rechtssprechung nicht zwingend. Wichtig ist es, um spätere Diskussionen und Störungen in der TherapeutInnen-PatientInnen-Beziehung zu vermeiden, diese Vereinbarung noch vor Therapiebeginn und nach Möglichkeit schriftlich im Therapievertrag zu treffen. Bei höher frequenten Behandlungen (2-3 Sitzungen pro Woche) empfiehlt es sich, weitere Vereinbarungen zu treffen. Das Ausfallhonorar sollte sich z. B. in der Höhe deutlich ermäßigen. Das Ausfallhonorar können Sie nur mit einer Privatrechnung über die im Therapievertrag schriftlich fixierte Höhe des Ausfallshonorars einfordern. Das erhaltene Honorar müssen Sie als Einkommen deklarieren und entsprechend versteuern.
Sprechen Sie sich auch bezüglich dieses Punktes mit ihrem/ihrer SupervisorIn ab.
[1] JVEG: Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz