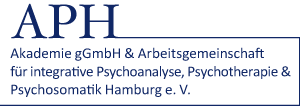Antragsformulare gemäß Psychotherapievereinbarung (PTV…) #
Eine ausführliche Hilfe zum Erstellen eines Therapieantrages finden Sie hier: PTV3
Um den Antrag auf Psychotherapie an die Kasse zu schicken, werden zunächst einmal folgende Formulare benötigt, die im Institut im Büro erhältlich sind:
- Antrag des Versicherten auf Psychotherapie (PTV1)
Dieser Antrag geben Sie bitte Ihrem/Ihrer PatientIn zum Ausfüllen und zur Unterzeichnung mit oder lassen ihn direkt vor Ort unterschreiben nachdem Sie mit ihm /ihr durchgegangen sind, was er/sie dort beantragt/unterschreibt (Therapieverfahren, KZT oder LZT, etc.). Eine Durchschrift erhält Ihr/e PatientIn für seine Unterlagen.
- Angaben des Therapeuten zum Antrag des Versicherten (PTV2)
Hier müssen Sie ausfüllen, ob es sich um einen Kurzzeittherapie (KZT) oder um einen Langzeittherapie (LZT), um einen Erst- oder Umwandlungs- oder Fortführungsantrag handelt, wie viele Stunden Sie insgesamt beantragen, welches Verfahren und mit welcher wöchentlichen Frequenz. Auch ist die entsprechenden EBM – Nummer einzutragen (s. unter Abrechnungsziffern).
Dieser Antrag wird von Ihnen und Ihrem Supervisor/Supervisorin unterschrieben und abgestempelt. Schreiben Sie zu ihrer Unterschrift (über/unter den Kasten) das Wort: Ausbildungsfall.
- Konsiliarbericht: Auf den Konsiliarbericht müssen Sie oben rechts das Institutskennzeichen: IK-Nr. 490 201 980 im Feld Arztnummer/ LANR eintragen. Nicht den Eintrag der Chiffre auf dem Durchschlag für den/die GutachterIn vergessen.
- Den Antrag an den/die GutachterIn: Diesen Bericht verfassen Sie ohne ein Formular zu verwenden (nach PTV3 Vorlage) und müssen ihn mit dem Unterschrift und Stempel versehen. Außerdem muss Ihr/e SupervisorIn den Bericht leserlich unterschreiben (oder durch seinen/ihren Stempel seinen/ihren Namen erkennbar machen).
Der Gutachterantrag #
Während der Konsiliarbericht auf dem Weg zum /zur Arzt/Ärztin ist und Ihr/e PatientIn den Antrag ausfüllt, sollten Sie im Laufe der probatorischen Sitzungen den Antrag an den/die GutachterIn schreiben.
Seit 2017 ist es nicht mehr erforderlich einen Bericht für den Antrag auf Kurzzeittherapie an die Krankenkassen zu schicken bzw. das Gutachterverfahren zu bemühen. Für ihre Kurzzeittherapien ist es jedoch APH-intern wichtig, dass dennoch die Inhalte des Berichts ausformuliert vorliegen (Befund, Psychodynamik, Therapiekonzept, Prognose). KJPler müssen daher bei Beginn einer Kurzzeittherapie einen internen Bericht für den/die SupervisorIn anfertigen. Er sollte sich an der Vorlage für den Bericht an den Gutachter orientieren, sodass sie ihn bei einer Umwandlung in eine LZT dann als Grundlage nehmen können. Achten Sie darauf, dass das Datum auf Ihrem Antrag an den/die GutachterIn und auf dem Antrag des/der Versicherten das Datum nach der zweiten probatorischen Sitzung enthält. Nur dann kann die Therapie bewilligt werden.
Behandeln Sie nach den probatorischen Sitzungen Ihre/n PatientIn weiter, ohne das bereits einen Kostenübernahmeerklärung (KÜ) der Krankenkasse vorliegt, gehen Sie das Risiko ein, dass vielleicht die Behandlung gar nicht oder eine verringerte Stundenanzahl als die geforderte von Ihrem/Ihrer GutachterIn empfohlen und letztlich dann von der Krankenkasse bewilligt wird. Es kommt i.d.R. nicht vor, dass Sie gar keine Stunden bewilligt bekommen, aber eine geringere Stundenanzahl als die geforderte ist nicht unüblich. Sie sollten deshalb Ihrem/Ihrer PatientIn mitteilen, dass erst die KÜ der Krankenkasse klärt, wie lange Sie ihn/sie behandeln können. Dies ist wichtig, damit Ihr/e PatientIn keine falschen/unrealistischen Vorstellungen von dem Antragsverfahren haben. Zudem sollten Sie sich überlegen, ob Sie das (geringe) Risiko eingehen und Ihre/n PatientIn behandeln, ohne dass bereits die KÜ vorliegt oder ob Sie lieber die Behandlung bis zum Eingang der KÜ aussetzen wollen.
Es ist nicht vorgesehen, dass in diesem Zeitraum PatientInnenkontakte über die Gesprächsziffer (EBM 23220) abgerechnet werden. In Rücksprache mit dem/der SupervisorIn oder der Ambulanzleitung kann dies jedoch zum Beispiel zur Stabilisierung der PatientInnen eingesetzt werden.
Bevor man den Antrag erstellt, sollte man plausible Hypothesen über die funktionalen Zusammenhänge der Störung haben. Die Gutachtenanträge sind im wichtigen Punkt der Anträge (der Psychodynamik) oft ungenau. Für das Verständnis der Störung ist dies der zentrale Punkt des Berichtes. Häufig bleibt unklar, wie die Problematik aufrechterhalten wird. Aus Ihrer Beschreibung muss ein übergeordnetes, plausibles und konsistentes Modell der Aufrechterhaltung der Störung hervorgehen. Hierbei müssen sowohl die intrapersonalen als auch die interpersonellen funktionalen Aspekte berücksichtig werden.
Es muss deutlich werden, was der aktive Anteil des/der PatientIn an der Aufrechterhaltung der Störung ist. Vor allem bei chronischen Krankheitsbildern wird oft der sekundäre Gewinn, z. B. durch die Zuerkennung eines Behindertenstatus, Rente und Krankschreibung vernachlässigt.
Wichtig ist auch, die beantragte Psychotherapie in Zusammenhang mit vorausgegangenen ambulanten oder stationären Psychotherapien zu bringen sowie psychiatrische oder somatische Mitbehandlungen zu würdigen bzw. zu erwähnen. Ein Bericht über eine stationäre Psychotherapie sollte nicht nur beigelegt, sondern er sollte in seiner Bedeutung für die jetzt beantragte Therapie gewertet werden.
Die prognostische Einschätzung sollte realistisch sein. Besonders bei chronischen Störungen und einer langen Reihe früherer therapeutischer Bemühungen ist die Prognose oft nur eingeschränkt bzw. nur auf bestimmte Teilziele bezogen günstig. Einer günstigen Prognose entgegenstehende Umstände sollten nicht verschwiegen werden, da die Krankenkasse in der Regel Vorerkrankungen, Klinikaufenthalte, Arbeitunfähigkeitszeiten usw. dem/der GutachterIn mitteilt. Eine länger dauernde Arbeitsunfähigkeit (und der Bezug von Krankengeld) sowie laufende Rentenanträge müssen in ihrer Bedeutung für die Psychotherapie immer reflektiert werden. Mögliche Schwierigkeiten in der therapeutischen Beziehung sollten ebenfalls reflektiert und in ihrer prognostischen Bedeutung eingeschätzt werden.
Die inhaltliche Gestaltung des Berichtes gibt nachfolgende Gliederungen für PP- und KJP-Anträge vor.
Die Überschriften der Abschnitte der nachfolgenden Gliederungen sollen im Bericht nicht jeweils wiederholt werden, die Angaben der Abschnittsnummer genügt. Der Umfang des Berichtes soll 2 Din A4-Seiten nicht überschreiten und nur solche Angaben enthalten, die therapie- und entscheidungsrelevant sind. Der/die GutachterIn ist gehalten, bei wesentlicher Überschreitung dieses Umfangs den Bericht zur sachlichen Verdichtung an den/die VerfasserIn zurückzugeben.
Die Berichte sollen sich auf die Angaben beschränken, die für das Verständnis der psychischen Erkrankung, ihrer ätiologischen Begründung, ihrer Prognose und ihrer Behandlung erforderlich sind.
Diese kurze Beschreibung kann lediglich ein erster Eindruck und Überblick über Aspekte der Berichterstellung darstellen, hierzu gibt es umfangreiche Seminare und auch im Erstinterviewpraktikum erlernen Sie bereits Bereiche der Berichte gut zu formulieren.
Was kommt in welchen Briefumschlag bei Antragsstellung?
In den Umschlag an die Krankenkasse kommt das
- Formblatt: Antrag des/der Versicherten auf Psychotherapie PTV 1
- Formblatt: Angaben des/der TherapeutIn zum Antrag des/der Versicherten (PTV 2 „Krankenkasse“).
- Konsiliarbericht (Durchschlag Krankenkasse, großes Textfeld geschwärzt)
- der weiße Umschlag an den/die GutachterIn mit folgendem Inhalt
- Formblatt: Angaben des/der TherapeutIn (PTV 2, Durchschlag GutachterIn)
- Bericht an den/die GutachterIn: 2 – seitigen Bericht
- Konsiliarbericht (Durchschlag GutachterIn, oben links geschwärzt)
- ggf. ergänzende Befunde
Wichtig ist, dass der Umwandlungs-/Fortführungsantrag rechtzeitig vor Ablauf der bewilligten Behandlungsstunden gestellt wird (ca. 10 Sitzungen vor Ende).
Das Obergutachterverfahren
Sollten Sie eine Kontingentkürzung oder eine Ablehnung von einem/einer GutachterIn erhalten. Können Sie in Abstimmung mit dem/der PatientIn und Ihrem/Ihrer SupervisorIn einen/ ObergutachterIn anrufen. Dieser erhält den ursprünglichen Bericht an den/die erste/n GutachterIn sowie ihre Antwort auf die Anmerkungen und beschriebenen Mängel, welche in der Einschätzung des/der ersten GutachterIn zur Ablehnung führten. Dies ist vor allem unangenehm und oft Angstauslösend, daher sollten sie sich wirklich gut in der Supervision begleiten lassen. Es ist aber auch ein sehr seltener Fall und in der Akademie noch seltener, da die Vorbereitung durch das Erstinterviewpraktikum auf die möglichen Probleme im Gutachterverfahren gut vorbereitet.
Ablauf der Antragsstellung bei Fortführungsanträgen #
Seit 2017 liegt es in der Hand der Krankenkassen, ob das GutachterInverfahren erneut bemüht werden soll, wenn eine Langzeittherapie fortgeführt werden soll. Daher werden Sie zunächst einen Antrag auf „Verlängerung“/Fortführung mit PTV1 und PTV2 an die Kasse stellen.
Die Kasse wird dann „umgehend“ einen Bericht an den/die GutachterIn anfordern, wenn Sie es möchte. Dies ist momentan relativ selten der Fall, bei analytischen Behandlungen jedoch häufiger. Sie müssen dann „zeitnah“ einen Bericht nachliefern. Im Regelfall erhalten Sie die Kostenübernahme (KÜ) direkt zugestellt.