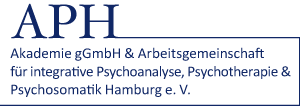Die praktische Ausbildung umfasst die selbstständige Durchführung von diagnostischen Untersuchungen und Behandlungen entsprechend dem eigenen Vertiefungsgebiet unter Supervision bei PatientInnen mit unterschiedlichen Störungen. Es ist ratsam, sich vor Beginn der ambulanten Tätigkeit zu überlegen, mit welchem/welcher SupervisorIn man gerne zusammenarbeiten möchte. Dafür bieten beispielsweise die Supervisionen der Erstinterviews eine Orientierung (Eine Übersicht der internen SupervisorInnen findet sich auf der Homepage unter „Lehrpersonal“). Fragen Sie die APH-SupervisorInnen frühzeitig nach freien Kapazitäten und vereinbaren Sie gegebenenfalls Kennenlerntermine. Es ist eine wichtige Regel, dass bei den ersten PatientInnen spätestens nach der ersten probatorischen Sitzung eine Supervisionsstunde zur Fallvorstellung stattfindet. Für alle weiteren PatientInnenbehandlungen gilt: In Absprache mit dem/der SupervisorIn ist auch eine erste Vorstellung nach der zweiten probatorischen Sitzungen möglich.
Wenn Sie VAKJP Mitglied werden möchten, achten Sie darauf die Grundanforderungen-der-VAKJP zu berücksichtigen.
Die Supervisionsstunden sind bei mindestens drei gemäß der APrV (Ausbildungs- und Prüfungsordnung) durch die APH-Akademie und der Behörde anerkannten SupervisorInnen abzuleisten. Die Behandlungsstunden sind auf die verschiedenen SupervisiorInnen möglichst gleichmäßig aufzuteilen (Richtwert: nicht mehr als 50% der Behandlungsfälle bei einem/einer SupervisorIn). Die SupervisorInnen müssen dem eigenen Vertiefungsgebiet und dem eigenen Berufszweig für die Pflichtstundenzahl entsprechen.
Nach jeder 4. Behandlungsstunde einer Therapie ist eine Einzel- oder Gruppensupervision durchzuführen. Bei Gruppensupervisionen soll die Gruppe aus max. 4 TeilnehmerInnen bestehen. Bei Gruppensupervision können als Supervisionsstunden nur die Stunden angerechnet werden, in denen eine eigene Fallvorstellung erfolgt. Die anderen Stunden können als Ausbildungsstunden in die freie Spitze angerechnet werden.
Eine Supervisionsstunde entspricht 45 Minuten. In einer Supervisionsstunde kann ein/e PatientIn ausführlich besprochen werden. Im späteren Verlauf kann es vorkommen, dass Sie über zwei PatientInnen berichten, dies wird die Gesamtzahl der notwendigen SV-Stunden jedoch nicht mindern. Zu Beginn der praktischen Ausbildung werden PatientInnen durchaus häufiger als alle 4 Stunden besprochen, um die Psychodynamik für den Bericht an den Gutachter eingehender behandeln zu können. In Notsituationen wird es nötig sein, von der allgemeinen Vorgabe abzuweichen und ebenfalls häufiger SV-Stunden in Anspruch zu nehmen. Umgekehrt können im späteren Verlauf in Absprache mit den SupervisorInnen auch in etwas größeren Abständen SV-Termine durchgeführt werden.
Dokumentiert werden die Ausbildungsbehandlungsfälle und die begleitende Supervision durch Angabe der Chiffrenummer, Diagnose, Anzahl der Supervisionsstunden und der Unterschrift des/der entsprechenden SupervisorIn im Studienbuch-KJP_TP bzw TP-PA des/der Aus-/ WeiterbildungsteilnehmerIn.
Art und Umfang der Behandlungsdokumentation als Vorbereitung auf die Supervision sind mit dem/der jeweiligen SupervisorIn zu besprechen. Neben der Begleitung des Behandlungsverlaufs unterstützt der/die SupervisorIn je nach Bedarf des/der Aus-/ WeiterbildungsteilnehmerIn auch das Antragsverfahren für die besprochenen Behandlungsfälle. Hauptverantwortliche/r für den Ausbildungsfall ist der/die SupervisorIn, der/die neben dem Aus-/ WeiterbildungsteilnehmerIn auch den Gutachtenantrag sowie die Formulare PTV2 und Briefumschlag unterschreibt.
Vor Aufnahme der Supervision sollte mit dem/der SupervisorIn besprochen werden, ob ggf. das Lesen von Anträgen außerhalb der Supervisionsstunde in Rechnung gestellt wird. Zudem unterstützen die SupervisorInnen für die von ihnen supervidierten Behandlungen ihre SupervisandInnen bei der Vorbereitung auf die Falldarstellung für die mündliche Prüfung.
Die SupervisorInnen rechnen die Supervisionsstunden direkt, per Rechnung, mit den Aus-/ WeiterbildungsteilnehmerInnen ab. Das Honorar richtet sich nach dem aktuell gültigen Kassensatz einer Behandlungsstunde plus minus 10%.
Bitte beachten Sie, dass Sie daher mit Ihren SupervisorInnen in einer inhaltlich/fachlichen Beziehung stehen. In diesem Rahmen haben die SupervisorInnnen Verantwortung und auch Weisungsbefugnis. Darüber hinaus stehen sie als VertragspartnerIn „auf Augenhöhe“ in einem Beziehungsverhältnis und werden Ausfallhonorare, Regelungen zu Terminabsagen, die Reduktion der SV-Frequenz am Ende der Ausbildung oder Ähnliches besprechen. Haben Sie hier bitte im Blick, dass diese organisatorischen Dinge innerhalb der kostenpflichtigen Supervisionsstunde stattfinden sollten.
Besonderes Qualitätsmerkmal innerhalb der APH ist es, dass die SupervisorInnen sich in SV-Konferenzen im jeweiligen Fachbereich mindestens einmal im Semester zusammenfinden und die Supervisionen bzw. die Arbeit mit den Aus-/ Weiterbildungsteilnehmers/in besprechen. Dies passiert ehrenamtlich durch die SupervisorInnen.
Damit hier die Transparenz gewahrt bleibt, wird ein von der Konferenz standardisierter SV-Beurteilungs-Bogens aus dem Fortschritte und Defizite hervorgehen, zwischen dem/der Aus-/ Weiterbildungsteilnehmers/in und dem SV vor der SV-Konferenz durchgesprochen und von beiden unterschrieben.
Konflikte in der Supervision und SV-Wechsel während einer laufenden Therapie #
In einer Supervision kann es zu Konflikten kommen. Diese können sich auch aufgrund sogenannter „Parallelprozesse“ entwickeln und für eine tiefere Reflexion des Behandlungsfalles fruchtbar gemacht werden.
Gelingt es SV und AWT nicht, über eine Reflexion der Supervisionsbeziehung eine Klärung zu erwirken, können sie sich gemeinsam für eine Beendigung der Supervisionsbeziehung aussprechen. Bei Beendigung einer Supervisionsbeziehung sind die AWT vom SV auch auf organisatorische Aspekte hinzuweisen. Die Klärung der Supervisionsbeziehung ist Bestandteil der Supervision und wird den AWT in Rechnung gestellt. Im Sinne einer fortgeschrittenen therapeutischen Haltung der AWT sollte ein solches klärendes abschließendes Gespräch auch in deren Interesse sein. Der Abbruch einer Supervisionsbeziehung steht stellvertretend als ein Lernbeispiel für den Umgang mit Beendigungen von therapeutischen Beziehungen und sollte klar als solche benannt werden.
Ist eine so skizzierte geordnete Beendigung der Supervisionsbeziehung nicht möglich, besteht für beide Seiten die Möglichkeit, das Vertrauensleutegremium der APH (siehe unten) zu kontaktieren. Mithilfe dieses neutralen Gremiums kann dann versucht werden, neue Lösungswege zu finden, oder ein Wechsel der SV bzw. Abbruch der Behandlung beschlossen werden.
Wird ein Behandlungsfall nicht mehr von dem/der Aus-/ WeiterbildungsteilnehmerIn bei dem/der SupervisorIn vorgestellt, der/die den Gutachtenantrag unterschrieben hat, muss eine Ummeldung erfolgen. Dazu bitte die Unterschrift des/der ersten SupervisorIn und das Enddatum der SV ins Studienbuch eintragen lassen. Diese Ummeldung ist wegen der Fallverantwortlichkeit des/der SupervisorIn wichtig. Sie geht mit der Ummeldung auf den/ die neue SupervisorIn über.
Außerdem sollte der SupervisorInnenwechsel per E-Mail der Geschäftsstelle angezeigt werden.
Das Vertrauensleutegremium #
In der APH existiert ein Vertrauensleutegremium, es kann im Konfliktfall hinzugezogen werden. Gemäß der Satzung der APH e. V. ist dieses Gremium folgendermaßen beschaffen:
10 Vertrauensleute-Gremium
Von der Mitgliederversammlung wird ein Gremium von drei fachlich und persönlich geeigneten Vertrauensleuten und zwei VertreterInnen gewählt, die für einen Zeitraum von drei Jahren tätig sind.
Die Wiederwahl ist möglich. Die wählbaren Vertrauensleute dürfen keine leitende Funktion in einem Organ oder Gremium des Vereins oder der Akademie der APH innehaben. Die Vertrauensleute sind Ansprechpartner für PatientInnen und deren in die Behandlung involvierten Bezugspersonen, sowie für AusbildungskandidatInnen, (Gast-)DozentInnen und für die Mitglieder der APH. Das Gremium wird auf Wunsch tätig bei Problemen im Behandlungs- und Ausbildungskontext sowie im kollegialen Zusammenhang. Die Vertrauensleute stehen ebenfalls als Ansprechpartner bei allen ethischen Konflikten und Fragen zu diesem Bereich sowie bei möglichen Grenzüberschreitungen zur Verfügung.
Die Tätigkeit der Vertrauensleute besteht ausschließlich darin, anzuhören, zu klären und zu beraten. Bei einem aktuellen Anlass werden die Vertrauensleute einzeln oder gemeinsam als AnsprechpartnerInnen tätig. Sie sind verpflichtet, mit den anderen Vertrauensleuten bzw. deren VertreterInnen zur gegenseitigen beratenden und klärenden Unterstützung zusammen zu treffen. Dabei ist es unabdingbar, dass die Anonymität der Rat- bzw. Hilfesuchenden gewahrt bleibt. Die Vertrauensleute sind grundsätzlich gegenüber Dritten zum Schweigen verpflichtet. Die aktuell gewählten Personen im Vertrauensleutegremium finden Sie im Semesterprogrammheft.
KandidatensprecherInnen als AnsprechpartnerInnen #
AusbildungskollegInnen haben außerdem die Möglichkeit, sich an die KandidatensprecherInnen der Akademie zu wenden. Sie garantieren eine von der Ambulanz- und Akademieleitung unabhängige Beratung und Unterstützung der Aus-/WeiterbildungskollegInnen in Konflikten und schwierigen Situationen. Die KandidatensprecherInnen arbeiten in jedem Fall unabhängig von der Geschäftsführung. D.h., Sie sind keiner Stelle in der Akademie verpflichtet. Somit ist die Verschwiegenheit in jedem Fall gewährleistet. Sie setzen sich auch u.a. auf Anregungen von AusbildungskollegInnen für Veränderungsvorschläge z. B. bezüglich struktureller Abläufe etc. ein.