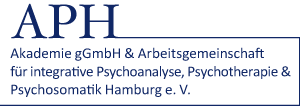- Patientenvergabe
- Notwendigkeit von Erstsichten ambulanter Patienten
- Verlauf nach der Erstsicht
- Patientenaufnahme
- Aufklärungspflichten
- Probatorik
- Umgang mit vorangegangenen probatorischen Sitzungen
- Umgang mit vorangegangen oder abgebrochenen Behandlungen
- Gesundheitskarte & alternativ auch Überweisungsschein
- PrivatpatientInnen
- Kassenwechsel
- Entscheidung für oder gegen die Patientenaufnahme
Patientenvergabe #
Die erste Kontaktaufnahme der Patienten erfolgt in der Regel über das Ambulanzsekretariat. Die Telefonnummern der Ambulanz für Patienten ist: 040 – 74 10 92 10. Die Sprechzeiten sind auf der Homepage aph-online.de unter „Ambulanz“ zu finden.
Der Patient wird zur Erstsicht eingeladen und aufgefordert, einen kurzen aber umfangreichen Fragebogen auszufüllen. Dieser wird zur Erstsicht mitgebracht oder per Post zugeschickt. Datenübermittlung per Email für die dort angegebenen sensiblen Daten ist nicht zu empfehlen. Nach der Erstsicht werden auf dem Weitervermittlungsbogen die vorläufig geeigneten Patienten über eine Warteliste an die Aus-/Weiterbildungskollegen verteilt. In der Erstsicht wird festgestellt, ob ein Patient für das Erstinterview-Praktikum, eine Behandlung in der Akademie oder für beides geeignet erscheint.
Für eine Vermittlung ist es auch notwendig, dass Sie Ihren Bedarf an per Mail an die Ambulanz mitteilen. Schreiben Sie in diese Mail, wie viele Patienten Sie in welchem Zeitraum aufnehmen wollen. Hier empfiehlt es sich möglichst mindestens 6 Wochen vor dem ersten Patienten-Termin die Anfrage loszuschicken. Geben Sie auch an, für welche Zeitfenster Sie Patienten suchen und ob es sich um das EI-Praktikum oder eine Behandlung handeln soll. Danach erhalten Sie die Patienteninformationen in Ihr Fach. Es wird auf verschiedene Kriterien für eine gleichmäßige Verteilung der Patienten geachtet. Es kann sein, dass nicht alle Ihre Anforderungen berücksichtig werden können, gerade wenn Sie nur eingeschränkte Zeiten anbieten können, ist es teils schon aus diesem Grund schwer Patienten zu finden.
Sie geben spätestens mit der Abrechnung des Patientenkontakts den Rückmeldebogen zurück in die Geschäftsstelle (in den Briefkasten, oder das Fach, wenn niemand anwesend ist), nur wenn dieser Bogen vorliegt und wir daher auch bei externen Anfragen sagen können, ob, wie und durch wen dieser Patient behandelt wird, kann eine Abrechnung im aktuellen Quartal erfolgen. Bei späterer Nachreichung des Formulars wird selbstverständlich auch dieser Patient nachträglich vollständig abgerechnet.
Sie können auch Patienten aufnehmen bzw. behandeln, welche nicht vorher in der Ambulanz auf der Warteliste waren. Wenn Sie beispielsweise Patienten bereits in Ihrer Tätigkeit als Stationsarzt/-ärztin oder als klinische/r PsychologIn in einem Krankenhaus kennen gelernt haben, können Sie diese Patienten ambulant aufnehmen. Sie müssen jedoch deutlich sagen, dass es sich jetzt um ein anderes Setting und eine andere Institution handelt. Sie werden im Rahmen dieser Erläuterung angeben, dass Sie die Behandlung im Rahmen Ihrer Aus-/Weiterbildung durchführen und dass daher eine Erstsicht (oder ggf. Zweitsicht, siehe unten) erforderlich ist. Geben Sie den Patienten daher eine Visitenkarte der APH Ambulanz, einen Flyer oder einfach die Kontaktdaten. Und sagen Sie deutlich, dass der Patient angeben soll, dass er in Behandlung oder Diagnostik (Erstinterview) zu Ihnen möchte. Dann wird regulär ein Termin für eine Erstsicht vereinbart und Sie erhalten direkt im Anschluss den Weitervermittlungsbogen in Ihr Fach.
Notwendigkeit von Erstsichten ambulanter Patienten #
Ausbildungsbehandlungen müssen bei Behandlungsbeginn einer ambulanten Psychotherapie zumindest einmal von einem/einer approbierten KollegIn persönlich gesehen werden (= „Erstsichten“), um grobe Fehlindikationen und Fehleinschätzungen zu vermeiden. Das ist keine Garantie gegen spätere Fehlentwicklungen in der Behandlung, aber ein Beitrag zur nötigen Sorgfaltspflicht. Der Justiziar der BPtK wies ein anderes Ausbildungsinstitut aus ggb. Anlass darauf hin, dass alleine schon durch das Fehlen eines persönlichen Kontaktes mit einem/einer approbierten PsychotherapeutIn (FA, PP, KJP) zu Beginn einer Psychotherapie mit der Unterstellung grober Fahrlässigkeit gerechnet werden muss. Daher wurden ab ca. 2010 in allen Ausbildungsinstituten entsprechende Patientenkontakte zur Absicherung eingeführt. Einen gewissen Interpretationsspielraum gibt es im Begriff „Beginn der Behandlung“. Dies wird in der APH so gewertet, dass es entweder vor dem Erstkontakt mit einem Aus-/Weiterbildungskollegen oder direkt nach dem ersten Kontakt zu dem Gespräch mit dem approbierten Therapeuten kommen muss. Wenn es möglich und sinnvoll erscheint, kann der Supervisor daher die Erstsicht übernehmen. Es darf jedoch nicht vorkommen, dass ein Patient mehrere probatorische Sitzungen hat, in denen zusammen mit dem/der SupervisorIn entschieden wird, dass eine Behandlung nicht in Frage kommt und dann gar nicht durch einen/eine fachkundige/n PsychotherapeutIn gesehen wird! Es sollte eine Aussage vorliegen, etwa wie: „Pat. ist vorläufig für eine weitere Behandlung oder Diagnostik als Ausbildungsfall geeignet…“, die in einem APH-Dokument oder Formular, von einem/einer approbierten TherapeutIn unterschrieben wird.
Verlauf nach der Erstsicht #
Aus der Erstsichtung der Ambulanz wird ein Weitervermittlungsbogen erstellt und Ihnen unterschrieben übergeben. Diesen Bogen nehmen Sie als Beleg in Ihre Patientenakte. Wenn Sie eine/n PatientIn aus einer (Lehr-)Praxis überwiesen bekommen, können Sie veranlassen, dass eine Erstsicht in der Ambulanz durchgeführt wird, müssen dies jedoch nicht. Sie benötigen dann jedoch ebenfalls einen schriftlichen Beleg, welcher darstellt, dass nicht nur ein approb. FA/PP/KJP den Kontakt durchgeführt hat, sondern auch eine Einschätzung zum „Ausbildungsfall“ vorgenommen wurde. Daher sind die Überweisungsscheine lediglich dann geeignet, wenn Sie aus einer Psychiatrischen / Psychotherapeutischen Praxis kommen (nicht von einem Hausarzt oder anderen Fachrichtung) und eine Formulierung wie „für Behandlung im Ausbildungskontext geeignet“ oder „Aus- /Weiterbildungsbehandlung möglich“ oder vergleichbares dort aufgedruckt ist. Wenn Sie diese „externe“ Erstsicht haben vornehmen lassen, schreiben Sie bitte auf den Rückmeldebogen in die Bemerkungen, bei wem und an welchem Datum die externe Erstsicht stattgefunden hat.
Im Gespräch zur Erstsicht werden die ersten Personendaten, Beschwerden, Therapievorerfahrungen, ein erster aktueller psychischer Befund und das Anliegen der Patienten erfasst. Es geht auch um die oben beschriebene Absicherung. Sie werden trotz dieses ersten Kontakts mit den Patienten dennoch selbst prüfen, ob eine Indikation besteht bzw. Sie die Therapie aufnehmen werden. Daraus folgt, dass Sie einige PatientInnen mit Sicherheit weiterverweisen werden, obwohl sie vorher in der Erstsicht insgesamt noch geeignet erschienen. An dieser Stelle ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, dass die PatientInnen oft genau wissen, dass sie von dem/der KollegIn im Erstkontakt keine psychotherapeutische Behandlung, welche sie ja i. d. R. dringend suchen, erwarten können. Daher entwickelt sich auch teils ein deutlich anderes Übertragungsgeschehen, gegenüber Ihren ersten Erfahrungen. Nicht alle PatientInnen, die sich telefonisch in der Ambulanz melden, kommen auf die Warteliste. Wir haben diesen Kriterienkatalog erarbeitet anhand dessen wir derzeit ca. 50-60% der Patienten an andere geeignete Stellen weiterverweisen müssen.
Patientenaufnahme #
Durch das Propädeutik-Seminar, das Erstinterview-Praktikum und die dort erstellten Berichte, sowie das Seminar zur Berichterstellung und die ersten Supervisionen im Erstinterview-Praktikum sollten Sie inhaltlich und fachlich gut auf die ersten Patientenkontakte vorbereitet sein. Es gibt jedoch diverse organisatorische, formale und rechtliche Dinge zu beachten, diese lernen Sie im folgenden kennen.
Aufklärungspflichten #
Aus rechtlicher Sicht ist es wichtig, dass Sie all Ihren Patienten vor Beginn der Therapie mitteilen, dass Sie als BehandlerIn in der Institutsambulanz tätig sind, um Ihre Approbation zu erwerben, sich also in der Aus-/Weiterbildung zum Psychologischen oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten befinden oder alternativ, dass Sie Ärztin sind und ihre Fachkunde erwerben. Bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren ist eine Zustimmmung beider sorgeberchtigter Elternteile nötig. Erwähnt werden muss außerdem, dass alle Behandlungsfälle regelmäßig supervidiert werden (Formular „Therapievertrag“).
Sie müssen ebenfalls auf den Datenschutz hinweisen. Hier reicht es aus, dass Sie den Hinweis auf einen Aushang zu diesem Thema geben. In der Ambulanz/Seewartenstraße hängt diese Erklärung zum Datenschutz aus. Außerdem sollten einige Kopien vorrätig sein, sodass PatientInnen auch der Hinweis gegeben werden kann, dass Sie diese Erklärung auch in Kopie bekommen können.
Zu beachten ist, dass die Grundlage einer psychotherapeutischen Behandlung der zwischen dem/der BehandlerIn und PatientIn abgeschlossene Behandlungsvertrag (auch Kontrakt oder Arbeitsbündnis genannt) ist. Dabei reicht schon eine mündliche Vereinbarung, es ist aber ratsam, wichtige Vereinbarungen im Therapievertrag zu besprechen.
Es ist wichtig, dass Sie Ihre PatientInnen ausführlich über den Vertrag informieren, denn nur dann können die Patienten auch ihr Einverständnis, d.h. ihre „informierte Zustimmung[1]“ geben.
Auch § 7 der (Muster-) Berufsordnung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten schreibt eine umfassende Informationsvermittlung, die hauptsächlich in den ersten Gesprächen stattfinden soll, vor. Dabei sollte beachtet werden, dass natürlich das Aufklären von PatientInnen oft keine einmalige Angelegenheit ist, sondern als kontinuierlicher Prozess verstanden werden kann. Denn häufig können die PatientInnen vor Aufregung in den ersten Sitzungen gar nicht alle wichtigen Informationen aufnehmen und manche Informationen liegen vielleicht in der Anfangsphase noch gar nicht vor oder sind später erst verfügbar. Geben Sie deswegen den Therapievertrag und die Patienteninformation zum Datenschutz, in dem alle wichtigen Informationen zusammengefasst sind mit. In der nächsten Sitzung sollen Sie wieder mitgebracht werden, damit Fragen und Unklarheiten besprochen werden können und spätestens dann unterschrieben werden, damit Sie diese zu ihrer Akte nehmen können.
Eine zweckmäßige Aufklärung sollte die Berücksichtigung der Befindlichkeit (z. B. Berücksichtigung bereits vorhandenen Wissens) und der Aufnahmefähigkeit (z. B. eine laienverständliche Erklärung) des/der PatientIn beinhalten. Ohne die mündliche Einwilligung des/der PatientIn zur Psychotherapie kann der Beginn der psychotherapeutischen Behandlung nicht erfolgen. Die Einwilligung des/der PatientIn zu diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen setzt die Erläuterung der nachfolgend aufgeführten Punkte in einem persönlichen Gespräch voraus.
- Ziel und Zweck der Therapie
- Art der Behandlung (z. B. Vertiefungsschwerpunkt und Methode, Unterschied zwischen Beratung und Therapie)
- Therapieplan (Therapieziele und Darlegung des Weges zur Erreichung dieser Ziele)
- Rahmenbedingungen der Ausbildungstherapie bzgl. Supervision und Einsicht der AmbulanzmitarbeiterInnen in die Behandlung
- Behandlungsalternativen
- mögliche Behandlungsrisiken, mögliche emotionale und psychische Belastungen durch die Therapie (z. B. prozessbegleitende Krisen und Symptomverschlechterungen)
- Informationen zu möglichen negativen Folgen einer Psychotherapie bei späteren Versicherungsabschlüssen (z.B. Forderungen von Risikozuschlägen oder Verweigerung von Vertragsabschlüssen bei der privaten Krankenversicherung/PKV oder einer Lebensversicherung/LV) oder einer möglichen Verweigerung der Verbeamtung. (Dies ist jedoch keine unweigerliche Folge, da die Wahrscheinlichkeit der vorzeitigen Dienstunfähigkeit in einer Untersuchung kurz vor der Verbeamtung eingeschätzt wird. Eine ambulante Psychotherapie wird jedoch seit Jahren nicht als Risiko gewertet, da Sie ja eher zur besseren Belastbarkeit beiträgt.)
- Rahmenbedingungen der Behandlung (z. B., Information über das bewilligte Stundenkontingent,Sitzungsdauer und –frequenz,Modus bei Ausfall von Therapie z. B. privat zu zahlendes Ausfallhonorar,voraussichtliche Gesamtdauer der Behandlung und Möglichkeiten der Unterbrechung oder der vorzeitigen Beendigung der Therapie)
- die eigene Mitwirkungspflicht im Behandlungsprozess
- Ergebnisse der Diagnostik aus den probatorischen Sitzungen
- Erfolgswahrscheinlichkeit der Therapie (Dies meint, dass die PatienteInnen unter Bezugnahme auf die Psychotherapieforschung z. B. darüber informiert werden sollten, zu welcher möglichen Wahrscheinlichkeit und in welchem zu erwarteten zeitlichen Umfang das vorgeschlagenen Behandlungsverfahren erfolgreich sein kann.)
Ziel ist es, die PatientInnen bei der Therapieentscheidung und –planung mit einzubeziehen und gemeinsam störungs- und verfahrensspezifische Therapieziele zu erarbeiten und festzulegen. Das Einbeziehen der PatientInnen in den Behandlungsverlauf und die Aufklärung über therapeutische Maßnahmen und patientengerechte störungsbezogene Informationen sollen Ihnen zur Überprüfung der Therapiemotivation des/der PatientIn dienen. Dies ist zudem eine weitere Grundlage der Arbeitsbeziehung zwischen ihnen und dem/der PatientIn.
Auch sollten Sie Ihre PatientInnen im Rahmen der Therapieplanung und –entscheidung auf die Möglichkeit des Einbezugs von nahen Bezugspersonen hinweisen. Dieser Einbezug bedarf bei erwachsenen PatientInnen unbedingt der Einwilligung des/der PatientIn. In der Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist es ein fester Behandlungsbestandteil. Bitte beachten Sie jedoch beim Einbezug von Dritten in jedem Fall Ihre Schweigepflicht. Nichts, was Ihnen Ihr/e PatientIn im Rahmen der therapeutischen Gespräche mitgeteilt hat, dürfen Sie ohne seine Einwilligung z. B. im Paargespräch einbringen.
Probatorik #
Die ambulante Patientenbehandlung beginnt i.d.R. mit 6 probatorischen Sitzungen (PS) (inklusive Bezugspersonenstunden) und einer Anamnesesitzung, bevor spätestens der Antrag an den/die GutachterIn geschrieben werden muss/sollte.
Für die Abrechnung ist es wichtig, dass Sie mindestens zwei Probatorische Sitzungen vor dem Antragsdatum durchführen, in der Regel werden Sie jedoch alle PS benötigen.
Seit 2017 existiert auch die „Psychotherapeutische Sprechstunde“. Diese Ziffern sind in der APH jedoch für die Erstsicht (3x 25 Min. Sprechstunde) und das Erstinterview-Praktikum (EI-P) reserviert. Sollten Sie eine/n PatientIn übernehmen, der/die nicht durch das EI-P gegangen ist, können Sie die Ziffer 35151/Sprechstunde in Rücksprache mit dem/der SupervisorIn und dem Sekretariat nutzen.
Sollte die Probatorik einmal einen ungewöhnlichen Verlauf nehmen, können Sie in Ausnahmefällen auch die sogenannte Gesprächsziffer /5x 10 Min. EBM:23220) verwenden. Dies aber nur in Rücksprache mit ihrem/Ihrer SupervisorIn.
Umgang mit vorangegangenen probatorischen Sitzungen #
Bitte fragen Sie im Ambulanzsekretariat nach, ob ggf. schon vorherige probatorischen Sitzungen bei AusbildungskollegInnen stattgefunden haben. Sollten PatientInnen bereits bei einem/einer anderen AusbildungskollegIn unseres Institutes probatorische Sitzungen in Anspruch genommen haben, werden diese dem Gesamtkontingent des/der PatientIn von insgesamt vier probatorischen Sitzungen zugerechnet. Dies wäre ein sehr ungewöhnlicher Fall und würde bedeuten, dass Sie keine vollständigen Unterlagen zu diesem/dieser PatientIn erhalten haben. Für die eigene Patientenbehandlung bedeutet dies, dass dann nur die verbleibenden probatorischen Sitzungen abgerechnet werden können.
Haben die PatientInnen zuvor bei einem/einer niedergelassenen KollegIn oder dem/der LehrpraxeninhaberIn bereits probatorische Sitzungen in Anspruch genommen, können Sie als neue/r BehandlerIn erneut ein Kontingent probatorische Sitzungen abrechnen. PatientInnen dürfen auch parallell zu „Ihrer“ Probatorik andere PsychotherapeutInnen kennenlernen. Es wird anschließend jedoch nur eine Richtlinienpsychotherapie bewilligt
Umgang mit vorangegangen oder abgebrochenen Behandlungen #
Bitte erfragen Sie auch gleich zu Beginn Ihrer probatorischen Sitzungen, ob der/die PatientIn bereits in den letzten zwei Jahren in psychotherapeutischer Behandlung gewesen ist. Es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass eine Therapie abgebrochen wurde, für die noch ein Stundenkontingent besteht, das Sie dann nach Absprache mit der Krankenkasse übernehmen können. Für gewöhnlich werden solche Patienten nach einer Erstsicht jedoch nicht an Sie weitervermittelt.
Wenn es bei der Vortherapie um eine Verhaltenstherapie handelte, kann ein Verfahrenswechsel oder auch eine erneute psychische Dekompensation des/der PatientIn (aufgrund aktueller/geänderter Lebensumstände) die Kostenübernahme einer Psychotherapie kurze Zeit nach einer vorausgehenden Therapie trotzdem begründen. Das selbe gilt für einen Settingwechsel, zum Beispiel bei vorausgegangener Gruppentherapie.
Gesundheitskarte & alternativ auch Überweisungsschein #
Wir empfehlen, gleich im Erstgespräch bzw. immer in der 1. Sitzung eines neuen Quartals die Krankenkassenkarte des/der PatientIn einzulesen, in den Räumen der Ambulanz (Seewartenstraße und Teilfeld) ist ein Lesegerät vorhanden.
Patienten ohne einen aktuellen Versicherungsnachweis können in der Ambulanz i.d.R. nicht behandelt werden. Bitte wenden Sie sich aber im konkreten Fall an die Ambulanzleitung.
PrivatpatientInnen #
Bitte behandeln Sie keine PrivatpatientInnen.
Kassenwechsel #
Im Falle eines Kassenwechsels müssen die PatientInnen eigenständig dafür sorgen, dass die neue Krankenkasse informiert wird. Bitte weisen Sie Ihre PatientInnen schon zu Beginn der Therapie mündlich und am besten auch schriftlich im Therapievertrag darauf hin, dass Sie Ihnen einen Kassenwechsel sofort mitteilen müssen. Ihre Aufgabe ist es dann, die Kostenübernahmeerklärung der alten Krankenkasse an die neue Kasse mit der Bitte um Kostenübernahme zu schicken. Bitte geben Sie dabei an, wie viele Behandlungsstunden noch nicht abgerechnet wurden. Die neue Krankenkasse stellt dann eine auf sich lautende, aktualisierte Kostenübernahmeerklärung (KÜ) aus.
Der nicht mitgeteilte Kassenwechsel stellt den vielleicht häufigsten Abrechnungsfehler dar. Geben Sie daher unbedingt den Hinweis auf die Mitteilung und kontrollieren / vergleichen Sie die Kasse mit den Scheinen der Vorquartale.
Entscheidung für oder gegen die Patientenaufnahme #
Natürlich kann es auch sein, dass Sie merken, dass Sie mit dem/der PatientIn nicht arbeiten können (z.B. wegen dem Störungsbild des/der PatientIn, Instabilität des/der PatientIn, keine ambulante Therapieindikation zum jetzigen Zeitpunkt aber auch Kollusion bzw. eine ganz individuelle Nicht-Passung). Besprechen Sie die Situation und die Gegenübertragungsgefühle mit Ihrem/Ihrer SupervisorIn und klären Sie die Möglichkeit des TherapeutInnenwechsels (bzw. die Verweisung an andere KollegInnen) und die Mitteilung dieses Vorhabens mit dem/der PatientIn. Bitte seien Sie sowohl dem/der PatientIn als auch sich selbst gegenüber achtsam. Wichtig ist, dass Sie Ihre PatientInnen nie ohne die Benennung von Alternativen (z. B. Adressen von stationären Einrichtungen, alternativen TherapeutInnen) gehen lassen. Holen Sie sich hierfür Unterstützung und Rat bei Ihrem/Ihrer SupervisorIn oder auch bei der Ambulanzleitung.
Sollte es nach dem Erstgespräch oder der zweiten Probatorischen Sitzung zu keiner Passung kommen, jedoch sehr deutlich sein, dass eine Behandlung durch eine/n andere/n Aus-/WeiterbildungskollegIn sinnvoll ist, können Sie den/die PatientIn wieder auf die Warteliste geben. Jedoch mit der Info über bereits durchgeführte probatorische Sitzungen und von dort erneut an eine/n andere/n AusbildungskollegIn vergeben.
Sollten sich in den ersten probatorischen Sitzungen andere (als in der Erstsicht und dem Erstinterview erfassten) Informationen und Zusammenhänge ergeben, die gegen eine ambulante (Ausbildungs-) Psychotherapie sprechen, besprechen Sie mit dem/der SupervisorIn, ob eine Rückgabe auf die Warteliste tatsächlich sinnvoll ist.
[1] Der Begriff „informierte Zustimmung“ bzw. „informed consent“ wird seit den 70er Jahren in der medizinischen Ethik diskutiert. Er beinhaltet das Prinzip des Respekts vor der Autonomie und dem Selbstbestimmungsrecht der Patienten.